Die Breite des Themas «(Un)sichtbarkeit» ermöglichte es der Militärgeschichte, sich einen Platz zu sichern. Ein gemeinsames Panel von MILAK und SVMM, gut organisiert und geleitet von unserem Mitglied Dr. Tamaro Cubito, versammelte gut fünfzig Personen, was beweist, dass das Thema nach wie vor auf Interesse stösst.
Hr. Andri Schläpfer, Doktorand, stellte einige Aspekte des Sonderbundskrieges vor, die «durch den Pulverdampf der Gewehre und Kanonen» (im wörtlichen wie im übertragenen Sinne) und durch die schnelle Entscheidung der Tagsatzungsarmee gegenüber den Kantonen des Sonderbundes verdeckt wurden. Nur der militärische Sieg und die daraus resultierende strukturelle Veränderung des Landes blieben allgemein im kollektiven Gedächtnis und in der offiziellen Geschichtsschreibung erhalten.
Aber oft wird vergessen, die Probleme bei der Organisation der Truppen zu erwähnen, die Versorgung der Verwundeten und Invaliden, die Motivation der Soldaten, die sich nicht mit den religiösen oder politischen Zielen der Konfliktparteien identifizieren konnten (weshalb es schwierig war, die Gegner als „Feinde” zu bezeichnen), die Aufrechterhaltung der Disziplin in der Truppe, aber auch die Gewalt, an die die Miliztruppen nicht gewöhnt waren.
Diese Aspekte wurden kaum dokumentiert oder analysiert, ebenso wie es nur wenige Gedenkstätten gibt. Aber sie blieben lange Zeit in den individuellen oder familiären Erinnerungen der betroffenen Menschen – auf beiden Seiten – präsent und wurden erst viel später verarbeitet. Es gäbe sicherlich viel zu tun, um die Aufarbeitung dieser prägenden Phase unserer Geschichte zu vervollständigen.
Dr. Mario Podzorski brachte eine wenig beachtete Sichtweise auf die Geschichte der Schweizer Armee während des Ersten Weltkriegs ein: die Entwicklung der Motivation bestimmter Offiziere im Laufe ihrer vierjährigen aktiven Dienstzeit. Zu diesem Zweck vertiefte er sich in die Lektüre zahlreicher Tagebücher und Briefe an ihre Familien.
Während man 1914 zunächst einen ausgeprägten Willen erkennen konnte, dem Land zu dienen und es zu verteidigen, folgt schnell Enttäuschung, da nichts passierte. Und dann kam monatelang nur der monotone und sich wiederholende Grenzschutz, der mit jeder Ablösung die Motivation für den Einberufungsgrund und den Verbleib unter der Fahne schwinden liess. Dann änderte sich das Bild des Gegners: Anstelle eines potenziellen militärischen Feindes aus dem Ausland misstraute man nun einem inneren Feind, der das Land und die Gesellschaft destabilisieren könnte. Dies führte zu einem neuen Motivationsschub, als es 1918 darum ging, Ordnungsdienst zu leisten.
Diese Entwicklungen sind interessant, wurden jedoch von ihren Urhebern verschwiegen, da sie persönlicher, ja sogar intimer Natur waren. Man kann sich jedoch unbestreitbar vorstellen, dass sie von den meisten mobilisierten Männern in ähnlicher Weise erlebt wurden. Dies zeigt, wie wichtig Kommunikation bei Führungsaufgaben ist, was in dieser Phase unserer Geschichte offensichtlich vernachlässigt wurde.
Prof. Dr. Stig Förster äusserte sich allgemeiner zu der Problematik der (Un)sichbarkeit der Militärgeschichte. Seiner Meinung nach ist die Militärgeschichte keineswegs unsichtbar, ganz im Gegenteil: Die Medien und die Bevölkerung sprechen regelmässig darüber. Unsichtbar geworden ist hingegen die Lehre und Forschung auf diesem Gebiet. Ein Beweis dafür ist das Verschwinden spezifischer Lehrstühle an den Universitäten... Diese wären jedoch notwendig, um stereotype Vorstellungen zu entstauben, vernachlässigte oder vergessene Fakten ans Licht zu bringen und die Wechselwirkungen zwischen politischen Entwicklungen und militärischen Aktionen, die als Folgen oder Auslöser angesehen werden, aufzuzeigen.
Diese Unsichtbarkeit der Forschung ist kein rein schweizerisches Phänomen, sondern in vielen Teilen der Welt und insbesondere in Westeuropa zu beobachten. Dadurch vergisst man das Wie und Warum von Kriegen und kehrt zu Mechanismen zurück, die zerstörerisch sein können!
Der Bedarf an Militärgeschichte ist durchaus vorhanden... aber niemand will sich daran machen, die Forschung und Verbreitung in diesem Bereich auf akademischer oder sogar institutioneller Ebene (wieder) anzukurbeln. Warum? Diese Frage zu stellen, ist vielleicht schon ein erster Schritt, um das Thema wieder aufzugreifen...
Die anschliessende Diskussion mit dem Publikum zeigte, dass man in der Vergangenheit zu sehr dazu neigte, der Militärgeschichte klare Grenzen zu anderen historischen Bereichen setzen zu wollen, und dass die «Grauzonen» nach und nach von anderen Bereichen vereinnahmt wurden, zum Nachteil des Themas, das uns interessiert. Die Militärgeschichte ist Teil der allgemeinen Geschichte, mit allen Folgen der Konflikte für die Gesellschaft, ihrer Wirtschaft, ihrer politische Struktur, ihrer sozialen und kulturellen Entwicklung. Man sollte sich nicht scheuen, dies vertieft zu erforschen. Aber man darf die Soziologie des Militärs nicht mit der Untersuchung der Macht in den Händen der Politik und des Staates vermischen; dieser zweite Aspekt wurde zugunsten des ersten tendenziell vernachlässigt. Tatsächlich müssen alle Parameter berücksichtigt werden, und vor allem darf der Faktor Mensch nicht vernachlässigt werden, der ein unverzichtbarer Bestandteil der Streitkräfte, aber auch die ursprüngliche Quelle aller Konflikte ist...
Dieses Panel bot eine hervorragende Gelegenheit, auf undogmatische Weise die Möglichkeiten aufzuzeigen, die das Erforschen und Verbreiten der Militärgeschichte bietet. Sein Inhalt und das Interesse, das es geweckt hat, bestärken die SVMM in der Verfolgung ihrer Ziele.









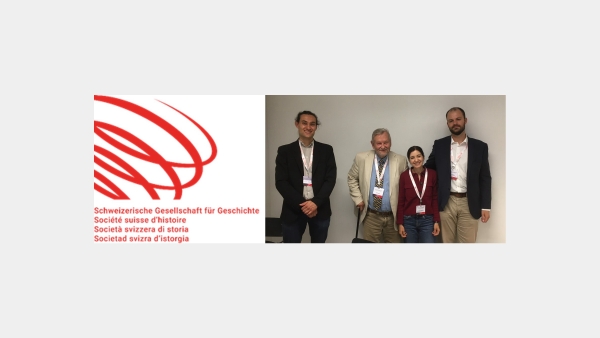

 Deutsch (Schweiz)
Deutsch (Schweiz)  Français
Français