Rechercher
Login
Seit vielen Jahren beschäftigt sich unser ehemaliges Vorstandsmitglied Hubert Foerster mit den Schweizer «Emigranten-Regimentern», die nach 1798 entstanden sind. Sie wurden meist mit englischem Geld im Kampf gegen die Napoleonischen Armeen angeworben und dienten für die Aufrechterhaltung der legitimistischen Staats- und Gesellschaftsverhältnisse. Nach der Aufhebung der französischen und sardisch-piemontesischen Fremdenregimenter entstand ein erhebliches Potential von arbeitslosen Söldnern, die sich in die meist nur kurze Zeit bestehenden Regimenter anwerben liessen. Das wohl bekannteste Emigranten-Regiment warb der Glarner Niklaus von Bachmann an, der von 1756 bis 1792 und 1815 in bourbonischen Diensten stand und 1815 von der Tagsatzung noch zum eidgenössischen General gewählt wurde.
MEINUNG - Geschichte der Schweizer Armee vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart Eine Rezension des Buches von Rudolf Jaun
Rudolf Jaun, emeritierter Professor für Geschichte der Neuzeit und Militärgeschichte an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich sowie Leiter des Department of Military History an der Militärakademie an der ETH Zürich bis 2012 schliesst mit der "Geschichte der Schweizer Armee vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart" eine Lücke. Das brillant geschriebene und sorgfältig bebilderte Buch ist die erste umfassende Darstellung der Armee des Kleinstaates im Herzen Europas, der sich – umgeben von Grossmächten – mit seiner Armee mit begrenzten personellen und finanziellen Mitteln über die Jahrhunderte gegen aktuelle und auch imaginäre Bedrohungen zu wehren hatte.
Ein Bürgerkrieg im November 1847 einte die Schweiz, auch entlang der Sprachgrenzen. Schulter an Schulter kämpften Deutschschweizer und Romands auf beiden Seiten.
Der Sonderbundskrieg, der am 3. November 1847 begann und schon am 29. November mit dem Sieg der liberalen Kantone über den katholisch-konservativen «Sonderbund» endete, ist ein Ruhmesblatt der Schweizer Geschichte: Immerhin forderte er rund 150 Tote und 400 Verwundete (über die endgültigen Zahlen wird gestritten). Dies stellt zwar eine eidgenössisch temperierte Opferbilanz dar; nicht umsonst hat der amerikanische Historiker Joachim Remak diesen Mini-Krieg – mit Blick auf den amerikanischen Sezessionskrieg – als «A Very Civil War» bezeichnet, als einen «sehr zivilisierten Bürgerkrieg». Aber für unser als Konkordanzdemokratie gepriesenes Land ist es doch etwas peinlich, dass auch hier der «nation building»-Prozess nicht ohne Krieg ablief.
Während des Ersten Weltkriegs war die Schweiz eine Plattform für alle Kriegsparteien, die ihre Neutralität und geografische Lage ausnutzten und hier Stützpunkte für ihre Spionage und Gegenspionage einrichteten. Die Aktivitäten der französischen, deutschen und österreichischen Dienste sind gut bekannt, im Gegensatz zu denen Russlands. Dieses Land hatte sich auch dafür entschieden, von der Schweiz aus zu spionieren, doch aufgrund fehlender Informationen verzögerte sich die Forschung zu diesem Thema. In den letzten Jahren wurden jedoch unveröffentlichte Dokumente aus russischen Archiven gesammelt, die den Schleier über diesen Aktivitäten lüften.
General Guillaume Henri Dufour (1797 - 1875) ist eine herausragende Persönlichkeit der Schweiz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Neben seiner entscheidenden Rolle im Sonderbundskrieg leitete er bemerkenswerte Arbeiten im Bereich der Kartografie und der Festungsbauten, setzte sich für die Ausbildung der Armee ein und war einer der Gründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Er war auch ein fruchtbarer Autor; doch wer hat in letzter Zeit das eine oder andere seiner Werke gelesen?
In der "Revue historique des armées (n°294)", die den Verlusten an Menschenleben in Kriegszeiten gewidmet ist, erinnert Prof. Dr. Nicolas Dujin daran, dass "die Verluste ein wesentlicher Gegenstand der Militärgeschichte sind. Sie zu zählen ist eine Notwendigkeit, um das Ausmaß eines Sieges oder einer Niederlage zu bewerten, ihre Ursachen zu ergründen eine Möglichkeit, die Stärken und Schwächen einer Armee zu erkennen".
MEINUNG - Der Obersten-Affäre: abgeschlossen, aber nicht gelöst - Eine Rezension des Buches von Fritz Stoeckli
Die "Obersten-Affäre" erinnert an eine kurze, aber intensive Episode unserer militärisch-politischen Geschichte während des Ersten Weltkriegs: Zwei hochrangige Armeeoffiziere wurden angeklagt und verurteilt, Informationen an die Mittelmächte weitergegeben und damit die Neutralität der Schweiz verletzt und die inneren Spannungen zwischen der französischen und der deutschen Schweiz geschürt zu haben. Brigadier Fritz Stoeckli, versiert in stabsmässigen Abläufen, militärgeschichtlich bewandert, präzise und sachlich wie ein Wissenschaftler, hat es geschafft, den Fall neu zu positionieren, das bereits Gesagte und Geschriebene zusammenzutragen und mit unveröffentlichtem Archivmaterial zu ergänzen. Ich habe dieses Buch mit Interesse und Vergnügen gelesen und kam nicht umhin, Extrapolationen vorzunehmen, die Fritz Stoeckli aufgrund seiner intellektuellen Strenge nicht machen konnte. Vielleicht gilt das auch für andere, die es lesen werden...
Geschichte ist die Beziehung, die Analyse, die Relativierung von vergangenen Ereignissen. Sie ermöglicht es auch - oder sollte es zumindest ermöglichen -, den Kontext zu verstehen, in dem sich die gegenwärtige Welt entwickelt. Dieser Kontext ist das Ergebnis einer Kaskade von Fakten und Ereignissen mit ihren Konsequenzen. Die vergangenen Fakten, die uns interessieren sollten, sind sowohl die von gestern als auch die von vorgestern oder von vor langer Zeit. Aber diese Kaskaden folgen (wie Wasserfälle in der Natur) einem Verlauf, der manchmal von Stößen, wenn nicht gar vom unaufhaltsamen Fluss der Zeit (bzw. der Wirkung der Schwerkraft) geprägt ist; es ist das Studium dieser Verlaufsänderungen, das interessant ist.
Martial Culture in Medieval Towns
Daniel Jaquet (Hg.) / Iason-Eleftherios Tzouriadis (Hg.) / Regula Schmid (Hg.) Martial Culture in Medieval Town.
Twenty-three short essays introduce the reader to the multifaceted martial culture of the late medieval and pre-modern European town. The stories in this richly illustrated anthology describe the ownership, handling, symbolism, use, and materiality of medieval weapons in their social, political, and cultural context. Originally contributions to the research blog “Martial Culture in Medieval Towns”, the selected and re-worked essays were edited to accompany the exhibition “Alarm! Culture, ownership, and use of weapons in the late medieval town” (Museum Altes Zeughaus / Old Arsenal Museum. Solothurn, 2022).
Nach dem Ersten Weltkrieg rüstete die Schweizer Armee ihre Panzerwaffe mit zahlreichen ausländischen Modellen auf, wie beispielsweise dem französischen Renault FT oder dem tschechischen Panzer 39. Im Kalten Krieg setzte die Schweizer Armee auf den bewährten britischen Centurion, ehe man in den späten 1950er Jahren mit dem Bau eines eigenen Panzers begann.

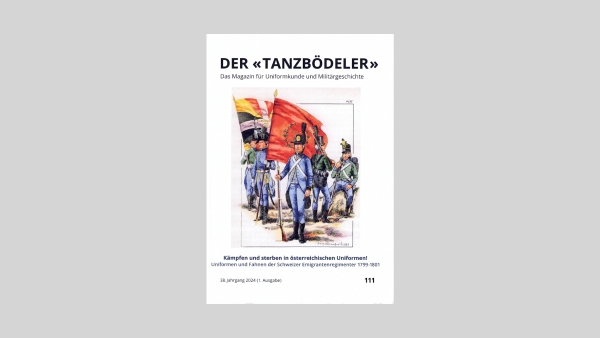
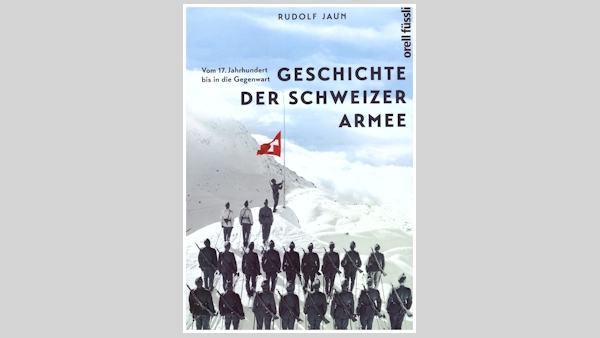

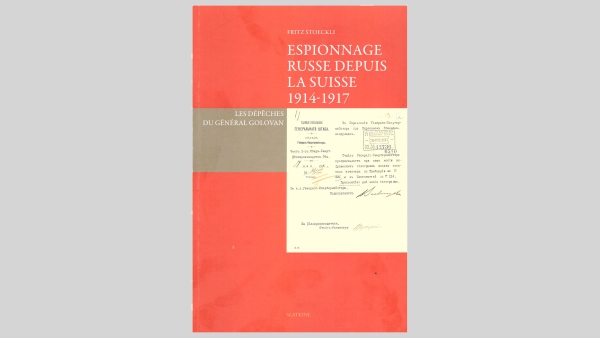
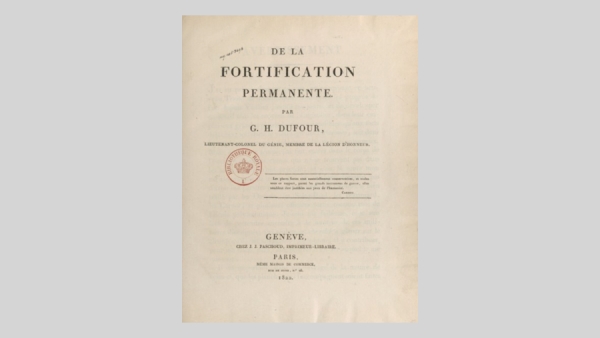

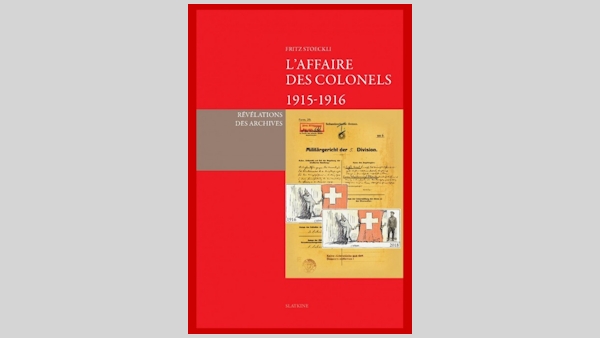

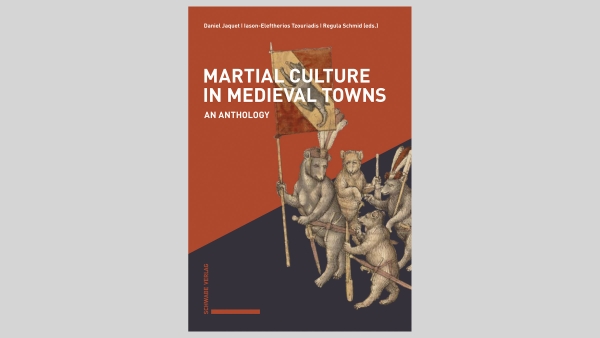

 Deutsch (Schweiz)
Deutsch (Schweiz)  Français
Français